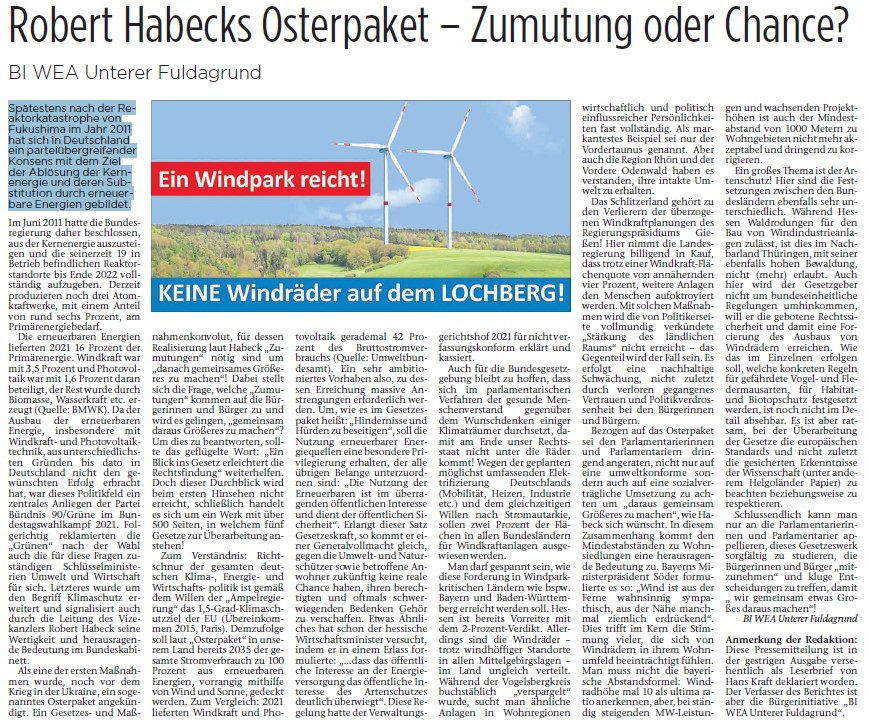Robert Habecks Osterpaket – Zumutung oder Chance?
BI WEA Unterer Fuldagrund
Spätestens nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 hat sich in Deutschland ein parteiübergreifender Konsens mit dem Ziel der Ablösung der Kernenergie und deren Substitution durch erneuerbare Energien gebildet.
Im Juni 2011 hatte die Bundesregierung daher beschlossen, aus der Kernenergie auszusteigen und die seinerzeit 19 in Betrieb befindlichen Reaktorstandorte bis Ende 2022 vollständig aufzugeben. Derzeit produzieren noch drei Atomkraftwerke, mit einem Anteil von rund sechs Prozent, am Primärenergiebedarf.
Die erneuerbaren Energien lieferten 2021 16 Prozent der Primärenergie. Windkraft war mit 3,5 Prozent und Photovoltaik war mit 1,6 Prozent daran beteiligt, der Rest wurde durch Biomasse, Wasserkraft etc. erzeugt (Quelle: BMWK).
Da der Ausbau der erneuerbaren Energie, insbesondere mit Windkraft- und Photovoltaiktechnik, aus unterschiedlichsten Gründen bis dato in Deutschland nicht den gewünschten Erfolg erbracht hat, war dieses Politikfeld ein zentrales Anliegen der Partei Bündnis 90/Grüne im Bundestagswahlkampf 2021. Folgerichtig reklamierten die „Grünen“ nach der Wahl auch die für diese Fragen zuständigen Schlüsselministerien Umwelt und Wirtschaft für sich. Letzteres wurde um den Begriff Klimaschutz erweitert und signalisiert auch durch die Leitung des Vizekanzlers Robert Habeck seine Wertigkeit und herausragende Bedeutung im Bundeskabinett.
Als eine der ersten Maßnahmen wurde, noch vor dem Krieg in der Ukraine, ein sogenanntes Osterpaket angekündigt.
Ein Gesetzes- und Maßnahmenkonvolut, für dessen Realisierung laut Habeck „Zumutungen“ nötig sind um „danach gemeinsames Größeres zu machen“! Dabei stellt sich die Frage, welche „Zumutungen“ kommen auf die Bürgerinnen und Bürger zu und wird es gelingen, „gemeinsam daraus Größeres zu machen“?
Um dies zu beantworten, sollte das geflügelte Wort: „Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung“ weiterhelfen.
Doch dieser Durchblick wird beim ersten Hinsehen nicht erreicht, schließlich handelt es sich um ein Werk mit über 500 Seiten, in welchem fünf Gesetze zur Überarbeitung anstehen!
Zum Verständnis: Richtschnur der gesamten deutschen Klima-, Energie- und Wirtschafts- politik ist gemäß dem Willen der „Ampelregierung“ das 1,5-Grad-Klimaschutzziel der EU (Übereinkommen 2015, Paris). Demzufolge soll laut „Osterpaket“ in unserem Land bereits 2035 der gesamte Stromverbrauch zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien, vorrangig mithilfe von Wind und Sonne, gedeckt werden. Zum Vergleich: 2021 lieferten Windkraft und Photovoltaik gerademal 42 Prozent des Bruttostromverbrauchs (Quelle: Umweltbundesamt).
Ein sehr ambitioniertes Vorhaben also, zu dessen Erreichung massive Anstrengungen erforderlich werden.
Um, wie es im Gesetzespaket heißt: „Hindernisse und Hürden zu beseitigen“, soll die Nutzung erneuerbarer Energiequellen eine besondere Privilegierung erhalten, der alle übrigen Belange unterzuordnen sind: „Die Nutzung der Erneuerbaren ist im überragenden öffentlichen Interesse und dient der öffentlichen Sicherheit“.
Erlangt dieser Satz Gesetzeskraft, so kommt er einer Generalvollmacht gleich, gegen die Umwelt- und Naturschützer sowie betroffene Anwohner zukünftig keine reale Chance haben, ihren berechtigten und oftmals schwerwiegenden Bedenken Gehör zu verschaffen. Etwas Ähnliches hat schon der hessische Wirtschaftsminister versucht, indem er in einem Erlass formulierte: „…dass das öffentliche Interesse an der Energieversorgung das öffentliche Interesse des Artenschutzes deutlich überwiegt“. Diese Regelung hatte der Verwaltungsgerichtshof 2021 für nicht verfassungskonform erklärt und kassiert.
Auch für die Bundesgesetzgebung bleibt zu hoffen, dass sich im parlamentarischen Verfahren der gesunde Menschenverstand gegenüber dem Wunschdenken einiger Klimaträumer durchsetzt, damit am Ende unser Rechtsstaat nicht unter die Räder kommt! Wegen der geplanten möglichst umfassenden Elektrifizierung Deutschlands (Mobilität, Heizen, Industrie etc.) und dem gleichzeitigen Willen nach Stromautarkie, sollen zwei Prozent der Flächen in allen Bundesländern für Windkraftanlagen ausgewiesen werden.
Man darf gespannt sein, wie diese Forderung in Windparkkritischen Ländern wie bspw. Bayern und Baden-Württemberg erreicht werden soll. Hessen ist bereits Vorreiter mit dem 2-Prozent-Verdikt. Allerdings sind die Windräder – trotz windhöffiger Standorte in allen Mittelgebirgslagen – im Land ungleich verteilt.
Während der Vogelsbergkreis buchstäblich „verspargelt“ wurde, sucht man ähnliche Anlagen in Wohnregionen wirtschaftlich und politisch einflussreicher Persönlichkeiten fast vollständig. Als markantestes Beispiel sei nur der Vordertaunus genannt. Aber auch die Region Rhön und der Vordere Odenwald haben es verstanden, ihre intakte Umwelt zu erhalten.
Das Schlitzerland gehört zu den Verlierern der überzogenen Windkraftplanungen des Regierungspräsidiums Gießen!
Hier nimmt die Landesregierung billigend in Kauf, dass trotz einer Windkraft-Flächenquote von annähernden vier Prozent, weitere Anlagen den Menschen aufoktroyiert werden. Mit solchen Maßnahmen wird die von Politikerseite vollmundig verkündete „Stärkung des ländlichen Raums“ nicht erreicht – das Gegenteil wird der Fall sein. Es erfolgt eine nachhaltige Schwächung, nicht zuletzt durch verloren gegangenes Vertrauen und Politikverdrossenheit bei den Bürgerinnen und Bürgern.
Bezogen auf das Osterpaket sei den Parlamentarierinnen und Parlamentariern dringend angeraten, nicht nur auf eine umweltkonforme sondern auch auf eine sozialverträgliche Umsetzung zu achten um „daraus gemeinsam Größeres zu machen“, wie Habeck sich wünscht. In diesem Zusammenhang kommt den Mindestabständen zu Wohnsiedlungen eine herausragende Bedeutung zu. Bayerns Ministerpräsident Söder formulierte es so: „Wind ist aus der Ferne wahnsinnig sympathisch, aus der Nähe manchmal ziemlich erdrückend“.
Dies trifft im Kern die Stimmung vieler, die sich von Windrädern in ihrem Wohnumfeld beeinträchtigt fühlen.
Man muss nicht die bayerische Abstandsformel: Windradhöhe mal 10 als ultima ratio anerkennen, aber, bei ständig steigenden MW-Leistungen und wachsenden Projekthöhen ist auch der Mindestabstand von 1000 Metern zu Wohngebieten nicht mehr akzeptabel und dringend zu korrigieren.
Ein großes Thema ist der Artenschutz!
Hier sind die Festsetzungen zwischen den Bundesländern ebenfalls sehr unterschiedlich.
Während Hessen Waldrodungen für den Bau von Windindustrieanlagen zulässt, ist dies im Nachbarland Thüringen, mit seiner ebenfalls hohen Bewaldung, nicht (mehr) erlaubt. Auch hier wird der Gesetzgeber nicht um bundeseinheitliche Regelungen umhinkommen, will er die gebotene Rechtssicherheit und damit eine Forcierung des Ausbaus von Windrädern erreichen.
Wie das im Einzelnen erfolgen soll, welche konkreten Regeln für gefährdete Vogel- und Fledermausarten, für Habitat und Biotopschutz festgesetzt werden, ist noch nicht im Detail absehbar. Es ist aber ratsam, bei der Überarbeitung der Gesetze die europäischen Standards und nicht zuletzt die gesicherten Erkenntnisse der Wissenschaft (unter anderem Helgoländer Papier) zu beachten beziehungsweise zu respektieren.
Schlussendlich kann man nur an die Parlamentarierinnen und Parlamentarier appellieren, dieses Gesetzeswerk sorgfältig zu studieren, die Bürgerinnen und Bürger „mitzunehmen“ und kluge Entscheidungen zu treffen, damit „ wir gemeinsam etwas Großes daraus machen“!